Struktureller Rassismus auf Reisen: Was das ist und wie du ihn vermeidest
Struktureller Rassismus auf Reisen: Was das ist und wie du ihn vermeidest
Die sozialen Medien waren in den vergangenen Wochen zuerst: Schwarz. Die gefärbten Quadrate waren gleichsam Protest und Mahnung und wichen dann Stimmen Schwarzer Menschen. Diese sagen seit Jahren und Jahrzehnten: Wir werden strukturell rassistisch benachteiligt.
Das muss sich ändern! Was ist das eigentlich, struktureller Rassismus? Woran merke ich ihn und wie kann ich vermeiden, seine Narrative zu bedienen? Dieser Beitrag soll erklären was struktureller Rassismus ist, zeigen wie er sich äußert und wertvolle Hinweise geben, wie du ihn auf Reisen vermeidest.
Funkloch ist ein Reiseblog mit Fokus auf Nachhaltigkeit. Reisen haben immer die Prämisse inne, dass zwei Kulturkreise aufeinander treffen. Bei solchen Begegnungen kommt zwischen den Leuten oft zu impliziten Rassismen, auch, wenn man es gar nicht so meint. Das ist Teil des strukturellen Rassismus.
 Was ist struktureller Rassismus?
Was ist struktureller Rassismus?
Struktureller Rassismus, oder auch institutioneller Rassismus unterscheidet sich von explizit rassistischen Handlungen wie Beleidigungen, Anfeindungen oder gewalttätigen Übergriffen aufgrund der Hautfarbe. Was George Floyd in Minneapolis widerfahren ist, war rassistisch motivierter Mord. Solche furchtbaren Übergriffe sind allerdings häufig ein Teil eines größeren Systems. Diese jahrzehntelange Unterdrückung und Ausbeutung gibt es in den unterschiedlichsten Ausprägungen.
In internationalen Dynamiken geht es dabei immer um Machtverhältnisse: Gesetzlich unterstützt war Rassismus zum Beispiel während der Kolonialzeit, als sich die kolonialisierenden Länder Europas sich als entwickelt betrachtet haben. Die kolonialisierte Bevölkerung des Globalen Südens, wie Afrika, hingegen galt aus westlicher Sicht als barbarisch und fremd. Und dementsprechend wurden sie behandelt. Solche Narrative leben weiter. Wenn auch wie in diesem Beispiel das Terrorregime der Apartheid abgeschafft wurde. Struktureller Rassismus, oder auch institutioneller Rassismus ist also in erster Linie eins: aus einer staatlichen Perspektive genehmigt: Ausgeführt von Polizei, Behörden oder Gerichten. Praktisch entsteht dann so etwas wie Racial Profiling: Wenn Beamte in Grenzkontrollen dezidiert diejenigen überprüfen, die anders aussehen als sie selbst. Oder wenn Schwarze Menschen, People of Colour (POC) oder Leute mit Migrationshintergrund keine Wohnung bekommen. Oder keinen Job, weil sie ein Kopftuch tragen, oder einfach nur, weil Haar- und Hautfarbe dunkler sind. Das sind Prozesse, die man als Außenstehende oder Außenstehender nicht wirklich mitbekommt, weil sie schwer zu greifen sind. Diese Form des institutionellen Rassismus gibt es auch in Deutschland.
Was ist Alltagsrassismus?
Aber dadurch, dass wir alle in diesem System leben und handeln, sind wir immer auch davon geprägt. So ergeben sich alltagsrassistische Taten, die vielleicht gar nicht böse gemeint sind, aber zustande kommen, weil der Staat nicht interveniert oder die Handlungen selbst nicht als rassistisch begreift. Oder weil einem selbst das Privileg, das man als weißer Menschen hat, noch nie bewusst geworden ist. Das ist dann der Fall, wenn man vermeintlich anders aussehende Leute fragt, wo sie denn eigentlich herkommen und sich mit der Antwort der Deutschen Stadt, in der sie geboren wurden, nicht zufrieden gibt. Oder wenn man sie fragt, ob man ihr Haar berühren darf. All das sind für den oder die Fragenden Kleinigkeiten und sie basieren oft auf aufrichtigem Interesse. Dennoch betonen sie eine Andersartigkeit zwischen dem Fragenden und dem Gefragten.
Indirekter struktureller Rassismus auf Reisen
Und genau diese Andersartigkeit ist es, die wir oft auch auf Reisen betonen. Die fremdartige Natur, unterschiedliche Kulturen und Bräuche, Essen, Kleidung, Lebensgewohnheiten. Wo hat diese Betonung der Andersartigkeit rassistische Grundzüge – und wie können wir sie vermeiden? Wir hier in Deutschland sind in der privilegierten Situation, dass wir in einem der wohlhabendsten und reichsten Länder der Welt sozialisiert wurden und leben. Oft gehen wir von unserem Lebensstandard aus, wenn wir unterwegs sind. Allerdings reisen wir häufig durch ärmere Länder, die einmal kolonialisiert wurden. Hier müssen wir besonders vorsichtig sein:
 1. Kleidung
1. Kleidung
Das Problem: Wir lesen darüber im Reiseführer und vergessen sie dann doch manchmal, wenn wir vorm Tempel stehen: Die angemessene Kleidung. Das zeigt, dass man sich mit der Kultur des anderen Landes doch nicht so recht auseinandergesetzt hat und sie weniger respektiert, als man es behauptet. Tempel und Moscheen sind religiöse Orte, oft mit jahrhundertealter Tradition. Diese Orte sind nicht nur touristische Wallfahrtsstätten, sondern haben eine tiefgreifende Bedeutung. Nicht die richtige Kleidung anzuhaben, wird schnell als beleidigend empfunden. Auch mit vor Ort gekaufter Kleidung muss man vorsichtig sein. Manche Kleidungsstücke werden zu bestimmten Zwecken oder an bestimmten Orten getragen. Wenn man diese übernimmt, ohne den Kontext zu kennen, macht man sich oft kultureller Aneignung schuldig: Das “cherrypicking” von anderen Kulturen, ohne sich der Nachteile bewusst zu sein, die die Person der anderen Kultur aufgrund von eben jenen Äußerlichkeiten ihr Leben lang hatte.
Was kann ich tun? Wer direkt mit den richtigen Körperteilen bedeckt erscheint und keine Schals von der Einrichtung ausleihen muss, kann Pluspunkte sammeln und zeigen: Respektvolles Reisen geht. Aber auch darüber hinaus ist es wichtig, darauf zu achten, was man trägt. Manche Städte, Inseln, Länder, Orte sind auch ohne Tempelanlagen religiös geprägt. Deshalb gilt: Bikini nur am Strand. Und sich vorab informieren, fragen, beobachten und es sehr sehr genau nehmen und nicht à la “Schwamm drüber, ist ja nicht so wichtig.”
2. Gesten
Das Problem: Es ist oft nett gemeint, Kindern Süßigkeiten zu schenken und sich mit Nachbarn im Bus zu unterhalten. Dennoch wird oft davon abgeraten oder zumindest betont, dass das nicht unproblematisch ist. Natürlich ist dieser Punkt vom Reiseland abhängig. Aber viele Kinder, die auf der Straße nach Süßigkeiten betteln, haben nicht die Möglichkeit, sich regelmäßig die Zähne zu putzen. Süßigkeiten schaden ihrer Gesundheit häufig langfristig eher. Wenn sie nach Geld fragen, ist die Situation ebenso schwierig. Vielleicht schicken ihre Eltern sie vor, um betteln zu gehen. Auch im Bus sollten wir vorsichtig sein: In einigen Ländern wird es als unangenehm empfunden, mit dem anderen Geschlecht ein Gespräch zu beginnen. Dies zu ignorieren, zeigt mangelndes Interesse an kulturellen Gegebenheiten. Denn man stellt die eigene Lockerheit und Sozialisierung über die, in deren Land man Gast ist.
Was kann ich tun? Die Kinder der Eltern fragen, ob es in Ordnung ist, den Kindern etwas zu schenken – oder sie fragen, worüber sich ihre Kinder freuen würden. Für das Busbeispiel: Nett lächeln und sich ansprechen lassen. So kann das Gegenüber entscheiden, ob es inmitten so vieler anderer Leute ein Gespräch anfangen möchte. Mehr Informationen gibt es hier.
3. White Saviourism
Das Problem: Anschließend an den letzten Punkt sind auch Handlungen, die gut gemeint sind. Wie das aktivistische Kollektiv @nowhitesaviors sagt: Good intentions are not good enough. Es ist nobel, wenn man sich aktiv dafür einsetzen möchte, dass es anderen Leuten in anderen Ländern besser geht. NoWhiteSaviors und andere kritisieren aber die Umsetzung: Oft werden die Leute, die die Hilfe erhalten, nicht gefragt, ob sie sie haben möchten, oder auf welche Art. Beispielsweise beim Volunteering. Ohne die nötigen Kompetenzen zu unterrichten, ist beispielsweise schlecht für die Kinder, da man nicht über die nötige Didaktik verfügt. Lehrer*innen vor Ort werden Jobs weggenommen. Man selbst zahlt für eine Erfahrung, die anderen unter dem Deckmantel von Hilfe auf verschiedenen Ebenen Schaden zufügt.
Was kann ich tun? Auch wenn es keine lebensbereichernde Erfahrung mit sich bringt: Oft ist Geld, das man an lokal geführte NGOs spendet, besser angelegt, als teure Hilfsreisen zu finanzieren. Auch große europäische NGOs machen hier nicht alles richtig – sie sind oft von weißen geführt. Wichtig ist es aber, denjenigen zuzuhören, die am empfangenden Ende der Ressourcen stehen.
4. Europäische Anbieter im Ausland
Das Problem: Sie haben Hochglanz-Websites, E-Mail-Adressen und Google-Bewertungen: Europäische Hotels, Restaurants und Tour-Guides im Ausland. Wir sind Internetbuchungen gewohnt und vertrauen Online-Bewertungen. Allerdings laufen wir so oft Gefahr, europäische oder westliche Anbieter als qualitativ besser einzustufen – auch wenn das nicht unbedingt der Fall ist. Der lokale Anbieter wird dann als nicht so professionell empfunden, was die Kluft zwischen den Kulturen vergrößert und Rassismen mehr Platz lässt.
Was kann ich tun? Reiseführer wie der Lonely Planet haben angefangen, mehr lokale Anbieter und Restaurants aufzunehmen: Das hilft der Wirtschaft und den Menschen vor Ort mehr. Natürlich sollte man vorsichtig sein, wem man sein Geld gibt. Aber lokale Touristen-Informationen bieten zuverlässige Informationen zu lokalen Anbietern.
5. Fotografieren auf Reisen
Das Problem: Klar, Urlaubsfotos gehören zu jeder Reise. Allerdings sollten wir uns immer die Frage stellen: Ist die Person auf dem Bild so dargestellt, wie ich mich selbst auch gern sehen würde? Oder hat sie dreckige Kleidung an, sieht ärmlich oder krank aus? Von solchen Fotografien sollte abgesehen werden, denn es nimmt der dargestellten Person ihre Würde – auch, wenn sie vielleicht für das Foto lächelt. Auch karge Wohnungen und Häuser fallen darunter. Ärmere Leute für spannende oder exotische Bilder auszubeuten, hat einen kolonialen Charakter, denn sie wurden in der Vergangenheit zur Exotisierung und “Anders”-Machung verwendet. Dies mündete sogar darin, dass Schwarze Menschen in Menschen-Zirkussen vorgeführt wurden.
Was kann ich tun? Die Travelbloggerin Lee, SpiritedPursuit, hat sich genau diesem Thema ausführlich gewidmet und hat eine Liste erstellt, wie wir auf Reisen ethisch unbedenklich fotografieren können und dabei keine Rassismen bedienen. Ganz oben: Immer erst fragen, ob man ein Bild schießen darf. Und natürlich: Sich der eigenen Intention bewusst sein. Weshalb möchte man dieses Bild schießen? Gibt es würdevollere Motive?
6. Erzählungen
Das Problem: Ähnlich wie bei Fotografien geht es bei Erzählungen um die Art der Repräsentation. Natürlich möchte man nach dem Urlaub tolle und einzigartige Geschichten erzählen. Allerdings läuft man Gefahr, Sachen zu sagen wie: die Leute dort sind arm aber glücklich. Sind sie wirklich glücklich? Indem man betont, dass sie arm sind, wenig haben, macht man den Unterschied zwischen „uns“ und „ihnen“ größer, als er vermutlich ist. Das lässt sich auch übertragen auf Kleidung, Kultur und so weiter.
Was kann ich tun?: Das Exotische ist immer spannend. Aber ist es nicht auch spannend, festzustellen, dass jemand so weit weg von hier vielleicht die gleiche Fußball- oder Basketballmannschaft mag, wie man selbst? Oder die gleichen Bücher? Alltags- und struktureller Rassismus lässt sich am besten bekämpfen, indem wir feststellen: Wir sind alles nur Menschen. Und gar nicht so fremd voneinander.
7. Bewusstsein
Das Problem: White Fragility, also weiße Zerbrechlichkeit, ist ein reelles Problem des strukturellen Rassismus, und auch von strukturellem Rassismus in Deutschland. Unsere Hautfarbe ist ein Privileg. Einer, mit dem wir geboren sind und der uns viele Türen in der Welt öffnet. Inhärentes Vertrauen, zum Beispiel. Im Ausland wird unsere Hautfarbe mit Geld und Wohlstand assoziiert. Sich dessen nicht bewusst zu sein, und zu denken: “Die Leute sind arm, aber so zufrieden”, ist ein Problem. Vielleicht sind sie einfach höflich. Vielleicht denken sie, bei unserer Hautfarbe müssten sie höflich sein. Bei Machtgefällen ist es selten der Fall, dass jemand grundlos handelt.
Was kann ich tun? Die Stichworte sind Bewusstsein und Critical Whiteness. Oder wie man es derzeit häufig in den sozialen Medien sieht: Dass man sich seines weißen Privilegs bewusst sein muss, bedeutet nicht, dass man nie schwere Zeiten im Leben hatte. Es bedeutet lediglich, dass die Hautfarbe nicht dazu beigetragen hat, es noch schwerer zu machen.
Fazit zu strukturellem Rassismus auf Reisen
In einer Zeit, in der #blacklivesmatter viral geht, sollten wir dies zum Anlass nehmen und uns genau über Machtgefälle und institutionellen Rassismus zu informieren. Am besten, indem wir POC und Schwarzen Menschen zuhören und ihnen mehr Raum in Medien und politischer Bildung geben.
Ökologisch nachhaltig reisen ist unglaublich wichtig. Aber unsere Taten sollten auch sozial nachhaltig sein: Sie sind niemals losgelöst von Situationen des institutionellen Rassismus, der in unseren Gesellschaften besteht.
Hinweis: Wir haben uns mit diesem Text die allergrößte Mühe gegeben und enorme Sorgfalt walten lassen. Steven und Mina haben lange über die Inhalte und diverse Fomulierungen diskutiert. Außerdem haben wir Erfahrungen und Meinungen von Menschen einfließen lassen, die von Rassismus betroffen sind. Mina studiert gerade Afrikawissenschaften im Master und hat im Rahmen ihrer Masterarbeit diverse Interviews geführt.
Letztendlich ist uns sicher nicht zu 100% ein ausreichend differenzierter Text gelungen. Das Thema ist so komplex, dass wir vieles nicht erwähnen konnten. Wenn ihr anderer Meinung seid oder Formulierungen ungenau oder falsch findet, dann lasst es uns jederzeit in den Kommentaren wissen.
Wichtige Ressourcen
Struktureller Rassismus in Deutschland
Aminata Belli
Interview im Tagesspiegel
Struktureller Rassismus
Layla F. Saad und ihr Buch “Me and white supremacy”
Frantz Fanon – Black Skin, White Masks
Edward Said – Orientalism
Ressourcen zu sozial nachhaltigem Reisen
https://hownottotravellikeabasicbitch.com/
https://www.instagram.com/p/BtrLfKXnjhD/?igshid=gp12jd38htx
NoWhiteSaviors


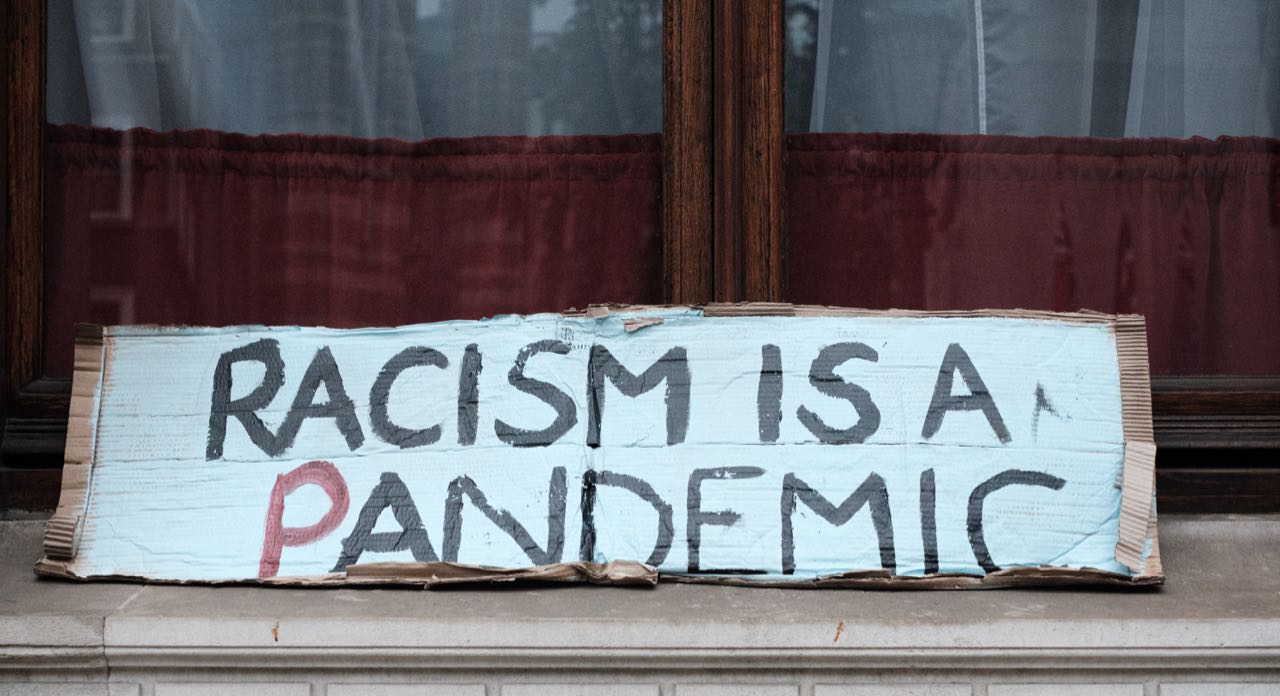
 Was ist struktureller Rassismus?
Was ist struktureller Rassismus? 1. Kleidung
1. Kleidung
No Comments